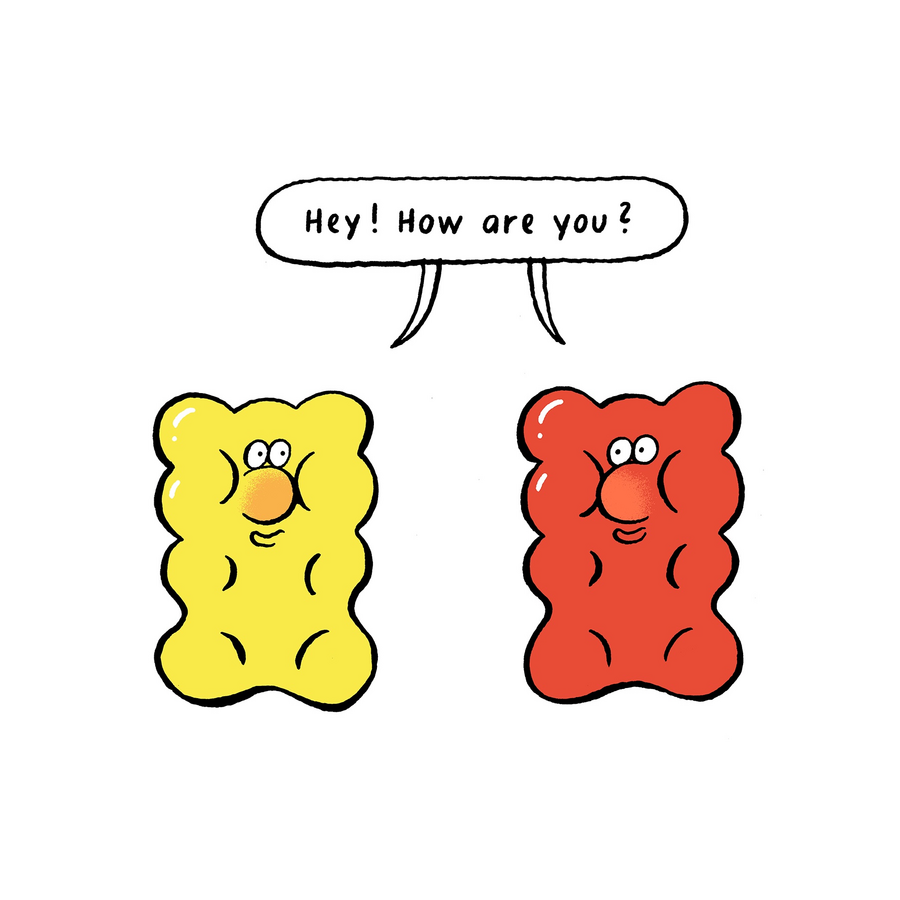Hier schreiben im Wechsel Christian Bartel, Juliana Kálnay und Melanie Raabe über Sätze, die ihnen hängengeblieben sind.
Hi, how are you today? Kaum einen Satz habe ich in den vergangenen Tagen öfter gehört als diesen. Von der jungen Frau, die mir morgens im Coffeeshop meinen Kaffee macht, vom Kassierer im Supermarkt, der Nachbarin, dem Kellner im Restaurant an der Ecke, dem Portier meines Hotels.
Jedes Mal, wenn ich in New York bin, fällt mir auf, wie viel Small Talk hier gemacht wird. Dieses Mal begann es schon im Flugzeug auf dem Weg in die USA. Rund die Hälfte der Passagier*innen war deutschstämmig, die andere Hälfte amerikanisch. Wir Deutsche bestellten unsere Getränke und sagten artig bitte und danke, die Amerikanerinnen*innen plauderten und scherzten mit dem Personal und redeten es nach rund acht Stunden Flug zum Teil schon mit dem Vornamen an. Meine (ebenfalls amerikanische) Sitznachbarin schlief zwar die meiste Zeit, aber während sie wach war, plauderte sie freundlich mit mir und bot mir sogar ein paar ihrer mit an Bord gebrachten Gummibärchen an. Die ich natürlich annahm, einfach, weil ich die Geste so nett fand. (Sie waren köstlich.)
Mir ist bewusst, dass manche Deutsche amerikanischen Small Talk bisweilen als oberflächlich empfinden. Ich hingegen mag ihn sehr. Das ritualisierte „Hi, wie geht’s Ihnen heute so?“ bildet stets den Auftakt zu einem kurzen Austausch, der ganz unterschiedlich weitergehen kann. Mal versichert man sich lediglich gegenseitig, dass es einem gut gehe und fertig, mal folgt angenehm belangloses Geplauder, mal entspinnen sich echte Gespräche – doch das ist zugegebenermaßen selten. So oder so passe ich mich diesem Ritual jedes Mal, wenn ich in New York bin, freudig an. Und nehme mir vor, fortan daheim in Deutschland genauso freundlich und offen zu sein – ein Vorsatz, den ich natürlich niemals langfristig in die Tat umsetze.
„ Ist die Freundlichkeit der New Yorker am Ende das Einzige, was die Menschen davon abhält, sich permanent gegenseitig an die Gurgel zu gehen? “
Dieses Mal blicke ich jedoch ein wenig anders auf die Freundlichkeit im Big Apple.
Vielleicht liegt es daran, dass der nächste US-amerikanische Wahlkampf vor der Tür steht und mir vor ihm graut. Vielleicht liegt es daran, dass mich die permanente Abfolge von Amokläufen, rassistischer Polizeigewalt oder anderen Schreckensnachrichten zermürbt hat. Vielleicht liegt es daran, dass mir die viel beschriebene Spaltung der amerikanischen Gesellschaft so bewusst ist. Auf jeden Fall blicke ich mit zunehmender Verwunderung auf die enorme Freundlichkeit der Menschen hier. Es ist, als gäbe es zwei Amerikas. Eines voller Gewalt, Hass und Zorn. Und eines, in dem Menschen einander die Türen aufhalten und sich bei jeder Gelegenheit freundlichst ankumpeln. Ich laufe durch Manhattan, und ich sehe allerlei Unschönes. Armut, Obdachlosigkeit, psychische Krankheit. Aber was ich nicht sehe, ist all der Hass, ist die massive Spaltung, von der ich morgens noch in der „New York Times“ gelesen habe.
Stets dachte ich, dass die Höflichkeit eine Funktion erfüllt. Liege ich falsch? Ist sie gar kein soziales Schmiermittel, sondern übertüncht lediglich die Probleme, die Spaltung, wie fern alle einander sind?
Oder ist die Freundlichkeit der New Yorker am Ende das Einzige, was die Menschen auf dieser so eng besiedelten Insel davon abhält, sich auch im Alltag permanent gegenseitig an die Gurgel zu gehen, so wie sie es sonst nur im Internet tun?
Machen Höflichkeit und Freundlichkeit die Welt besser? Ich weiß es nicht. Aber immerhin machen sie sie schöner, und das ist ja auch schon was. Ich werde also gleich wieder durch Manhattan stromern und andere bei jeder Gelegenheit mit „Hi, how are you?“ begrüßen. Und mir für den Rückflug eine Packung Gummibärchen ins Handgepäck stecken. Weniger Freundlichkeit ist auch keine Lösung.
Melanie Raabe mag eigentlich gar keine Gummibärchen, vergisst das aber manchmal. Sie lebt zwar nicht in Manhattan, aber immerhin im Rheinland, der freundlichsten und offensten Region Deutschlands.