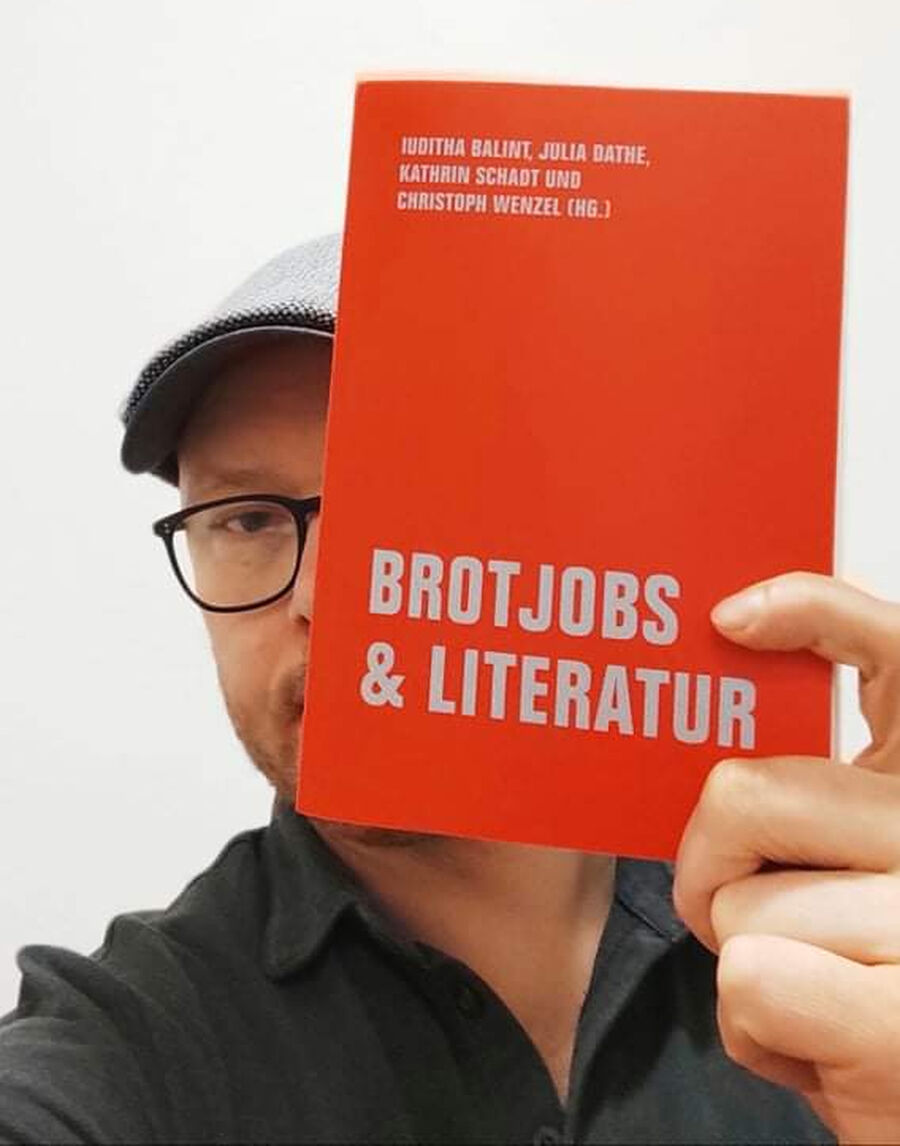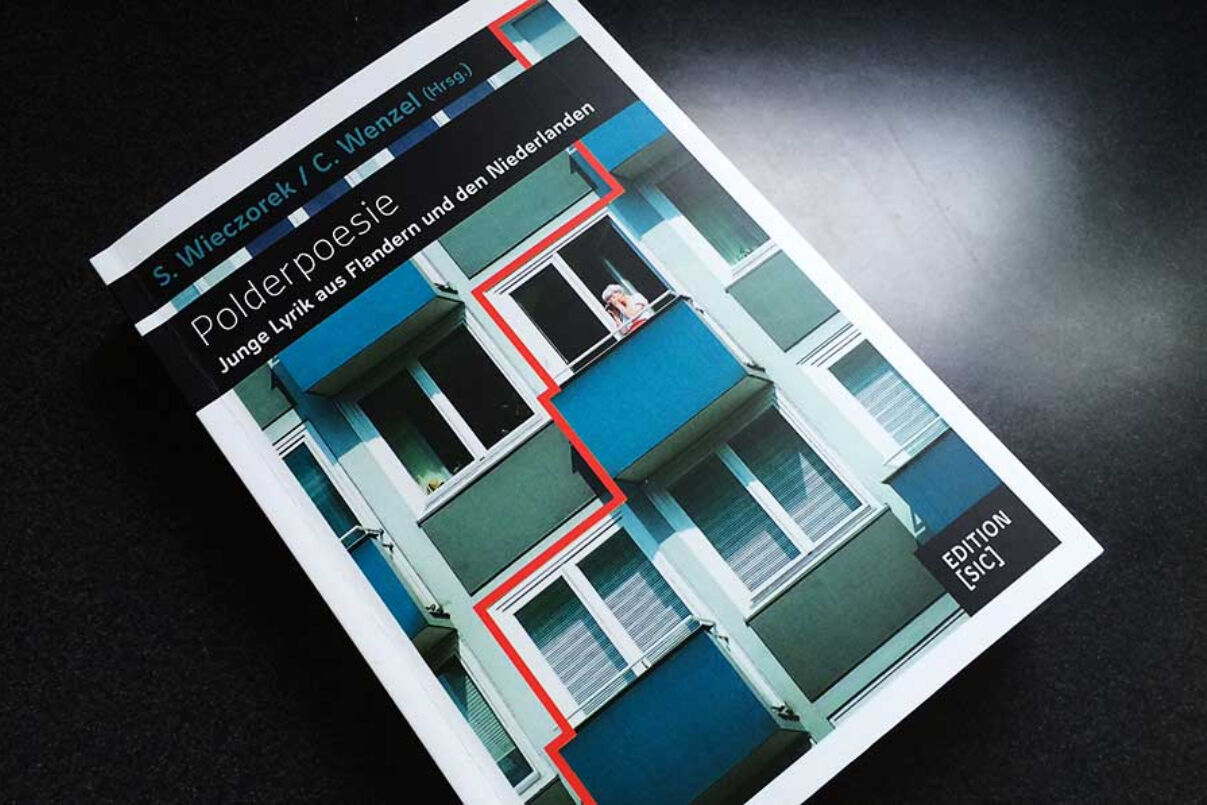Viele Autor*innen können vom Schreiben allein nicht leben. Über Geld wurde in der Szene bislang jedoch selten gesprochen. Das ändert sich nun: Das Buch „Brotjobs & Literatur“, herausgegeben u.a. vom Aachener Lyriker und Verleger Christoph Wenzel, rührt an ein Tabu und stößt eine Debatte über die Arbeitsbedingungen von Schriftsteller*innen an. Wir haben Christoph Wenzel ein paar Fragen zum Buch und zu seiner ganz persönlichen Situation als Autor gestellt.
Diese Initialzündung lässt sich sehr punktgenau ausmachen: Am 13. Oktober 2020 postete der Lyriker und Verleger Dinçer Güçyeter ein Foto von sich selbst auf Facebook, das ihn im Blaumann auf einem Gabelstapler zeigte. Im dazugehörigen Text beschrieb er seine Arbeit in einer Spedition, mit der er seinen Verlag ELIF, seine Familie und sich selbst finanziell über Wasser hält. Genau das war aus gleich mehreren Gründen sehr bemerkenswert. Sein Posting zeigte offen, exemplarisch und sinnbildlich: Autor*innen haben in der Regel auch Brotjobs, das heißt sie müssen häufig literaturfernen Arbeiten nachgehen, um weitere existenzsichernde Einnahmen zu erzielen. In den Lockdowns kam hinzu, dass vielen Schriftsteller*innen eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen wegbrach, nämlich bezahlte Lesungen, Auftritte, Moderationen etc. Viele Autor*innen waren so gezwungen, noch mehr als ohnehin schon, Geld mit Brotjobs zu verdienen. (Und selbst das gestaltete sich in der Pandemie häufig schwierig genug) Güçyeters Foto zeigt und thematisiert diese Umstände – auch ganz unabhängig von den durch die Pandemie noch verschärften Verhältnisse – offen, frei von Scham und auch ohne Larmoyanz. Das war insgesamt sehr ungewöhnlich, denn es wird kaum offen, weder unter Autor*innen noch gesellschaftlich, darüber gesprochen. Das Posting setzte schließlich nicht nur eine Diskussion über die realen Arbeitsbedingungen von Schriftsteller*innen in Gang, sondern erzeugte zudem eine spürbare Erleichterung: Ach, sahen viele, ich bin gar nicht allein in dieser Situation, den anderen geht es ja auch so oder zumindest ähnlich.
Darin bestätigte sich schließlich das, was das Herausgeber*innen-Teams längst ahnte: Es gibt einen großen Bedarf, das öffentlich zu machen, Autor*innen von ihren persönlichen Situationen berichten zu lassen – und das natürlich nicht nur, weil sprechen guttut, weil gesehen zu werden gut tut, sondern auch mit der Hoffnung, damit eine kulturpolitische Wirkung zu erzeugen – und sei es zunächst in Form einer öffentlichen Diskussion.
Im Diskussionsthread unter dem Foto fanden sich dann das Fritz-Hüser-Institut in Person von Iuditha Balint und Julia Dathe, Kathrin Schadt und ich zueinander – und die Idee einer Anthologie, in der wir Autor*innen, so offen sie wollten und in einer Form die ihnen behagt, berichten lassen, war dann schnell geboren.

Die Gründe sind durchaus sehr individuell, wie mir scheint. Es ist nicht zuletzt auch ein sehr deutsches Phänomen, das man nicht gern über Geld spricht, nicht gern über die eigene finanzielle Situation. Kaum jemandem wird wohl die Frage, ob er oder sie denn von seiner bzw. ihrer Arbeit leben könne, häufiger gestellt als Künstler*innen. Darin schwingt dann immer auch mit: Wenn du davon leben kannst, ist das was du machst gut und wertvoll. Wenn du nicht (allein) davon leben kannst, ist es wohl nicht gut genug, oder es geht eben nicht als Arbeit durch, sondern als Hobby und reine Selbstverwirklichung. Das ist natürlich Unsinn, aber es sorgt durchaus für Scham und erzeugt nicht selten Erklärungsnöte. Die marktwirtschaftliche Nachfrage ist aber kein zwingendes Qualitätsmerkmal für Kunst. Das sehen wir ja zum Beispiel auch an subventionierten Theatern oder Museen.
Das Gefühl, sich zu entblößen, sich angreifbar zu machen, sich einer Bewertung auszusetzen, spielt mit hinein. Aber ohne Öffnung keine Transparenz und ohne Transparenz kann kein Status quo aufgezeigt werden und ohne Bestandsaufnahme keine Sicht auf Veränderungsbedarfe und -möglichkeiten.
Überrascht und erschrocken hat uns, dass unsere Befürchtungen offenbar wahr sind: Eine künstlerische Tätigkeit wird teuer erkauft. Durch Broterwerbe, die die Zeit sowie körperliche und geistige Ressourcen knapp werden lassen, die mitunter selbst schlecht bezahlt sind, die aber allzu häufig nötig sind, damit Literatur überhaupt produziert werden kann. Der Literaturbetrieb baut also in Teilen darauf, dass die Produzent*innen sich allzu oft selbst ausbeuten müssen.
Überrascht hat uns Herausgeberinnen und Herausgeber zudem die Vielfältigkeit der Aspekte, die in der Summe der Beiträge zur Sprache kommen, die Offenheit, mit der viele der Beiträger*innen über ihre persönlichen Situationen sprechen, aber auch, wie in vielen Beiträgen klug und analytisch strukturelle und systemische Miseren in den Blick genommen werden – und das alles in nicht fiktionalen, aber dennoch durch und durch literarischen Beiträgen. Die informelle und vor allem auch die mediale Resonanz nach Veröffentlichung der Anthologie hat uns natürlich ebenfalls überrascht und gefreut. Sie ist die Voraussetzung für eine Diskussion über Verbesserungen.
Nötige und sinnvolle Veränderungen und Verbesserungen müssen meiner Meinung im Gespräch von Autor*innen mit Politik, Verlagen, Veranstalter*innen, den Bildungsinstitutionen etc. diskutiert werden. Es sind sicher nicht ein, zwei oder drei Stellschrauben allein. Dazu gehören meiner Ansicht nach aber durchaus: angemessene Mindesthonorare, Ausfallhonorare, ein neuer Zuschnitt von Stipendien (insbesondere Aufenthaltsstipendien, die häufig Eltern von schulpflichtigen Kindern benachteiligen), auch eine Art von Arbeitslosigkeitsversicherung für Freischaffende (es gibt solche Modelle in Belgien und Frankreich) – und natürlich auch ein Bewusstsein dafür, dass viele künstlerische Existenzen eben auf hybriden Modellen fußen (das heißt z.B. Freiberuflichkeit plus Teilzeitanstellung). Darauf waren etwa die Corona-Förderungen für Kulturschaffende gar nicht eingestellt.
Unter verbesserten Bedingungen würde ich meinen Brotjob mindestens noch weiter reduzieren, im Idealfall sogar komplett zugunsten einer Mehrfelderwirtschaft (wie ich sie im Grunde auch jetzt bereits betreibe) aus Schreiben, Publizieren und Auftritten, aus Herausgaben und Kurationen, aus Redaktionsarbeiten, Moderationen etc. aufgeben.
Am 5. Mai stellen stellvertretend Dinçer Güçyeter und Swantje Lichtenstein ihre Texte aus dem Buch vor und diskutieren mit Christoph Wenzel, Maren Jungclaus vom Literaturbüro und Annette Krohn von der Stadtbücherei Düsseldorf in der Zentralbibliothek Düsseldorf. Hier finden Sie mehr Informationen zur Veranstaltung.
Das Buch:
Brotjobs & Literatur
Iuditha Balint, Julia Dathe, Kathrin Schadt, Christoph Wenzel (Hg.)
erschienen im Verbrecher Verlag
240 Seiten