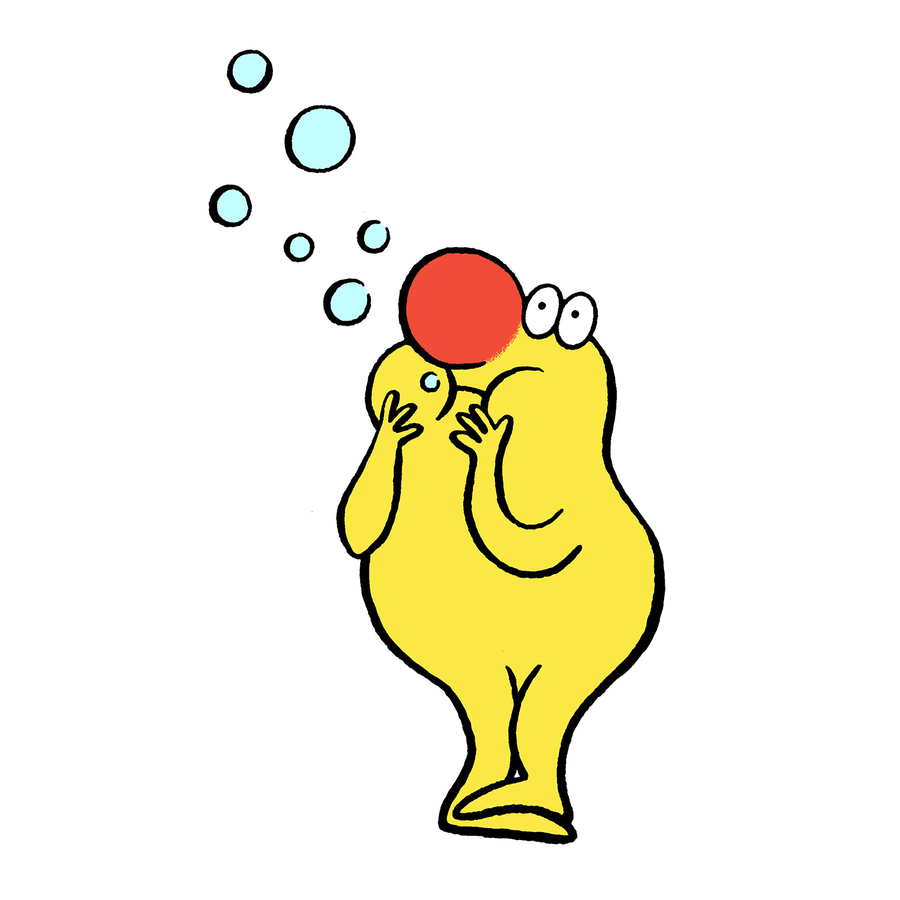Hier schreiben im Wechsel Christian Bartel, Juliana Kálnay und Melanie Raabe über Sätze, die ihnen hängengeblieben sind.
Kürzlich erfuhr ich, dass Seifenopern so heißen, weil die Ausstrahlung der nachmittäglichen soap operas im US-amerikanischen Radio der 1930er und 40er Jahre überwiegend von Waschmittelherstellern gesponsert wurde. Kurz darauf besuchte ich eine Veranstaltung auf einem Kölner Festival für Weltliteratur, bei dem die chilenische Künstlerin und Lyrikerin Cecilia Vicuña zu Gast war, und hörte dort erstmals von der „Gringo Soap“. Was dem Namen nach klingt wie ein Serien-Import aus den USA, bezog sich auf eine Methode mit der Cecilia Vicuña eingebläut wurde, „richtig“ Englisch zu sprechen. Als sie in den 1950er Jahre eine englische Schule in Chile besuchte, war es üblich, die Seife in kleine Stücke zu schneiden und jedem Kind eines in den Mund zu stecken, das dann beim Sprechen seifig schäumte und die spanische Muttersprache aus ihren Mündern auswusch.
Aus meiner eigenen Kindheit kenne ich die Drohung, wenn ich weiter Schimpf- beziehungsweise „schmutzige“ Wörter benutze, würde man mir den Mund mit Seife auswaschen. Doch in den 90ern blieb diese Drohung mehr Phrase, als dass sie tatsächlich in die Tat umgesetzt worden wäre. Ich weiß nicht, was es mit meiner Sprache gemacht hätte, wenn ich damals regelmäßig Seifenschaum im Mund geschmeckt hätte, ob sie tatsächlich „rein“ geworden wäre und ich seltener fluchen würde oder ob ich stattdessen in diesen Momenten verstummt und aus meinem Mund anstelle der Worte nur tonlose Seifenblasen gekommen wären, gefüllt mit heißer Luft. Eine Seifensprache, die den Klang der Worte ersetzt, ähnlich wie die Piepstöne, mit der Radiosender F- und andere Buchstabenwörter in Songs überspielen.
Zu Hause gebe ich jabón gringo in die Suchmaschine ein und stoße auf ein Werbeplakat aus den 50er Jahren, das die Seifenmarke Gringo mit dem Slogan in grammatikalisch fragwürdigem Spanglish „Yes, yes, mucho bueno“ bewirbt. Cecilia Vicuña und ihre Mitschüler*innen nannten die Seife also nicht nur so, weil ihre Zungen durch den Kontakt mit ihr die Sprache der Gringos erwerben sollten. Es war der tatsächliche Name einer verbreiteten Seifenmarke in Chile, die in ihren Werbebotschaften die Sprechweise von Englischsprechenden verwendete, die ihre ersten Gehversuche auf Spanisch wagten, und für deren Nachahmung man den Kindern womöglich ein weiteres Seifenstückchen auf die Zunge gelegt hätte.
„ Noch mehr erstaunt mich aber die Vorstellung, (…) eine möglichst ‚saubere‘ Sprache als etwas Erstrebenswertes zu begreifen. “
Man scheint Seife eine beachtenswerte Fähigkeit zuzuschreiben, wenn es darum geht, das, was als schmutzig und bedrohlich wahrgenommen wird, abzuwehren. Mit ihr kann man sich einer Redensart zufolge sogar die Hände von Schuld frei waschen. Und indem wir im Frühjahr 2020 nach jedem Supermarktbesuch die Hände dreißig Sekunden lang gründlicher denn je einseiften, hofften wir, von einer Ansteckung mit dem Coronavirus verschont zu bleiben. Doch während Seife den Keimen, mit denen wir in Berührung gekommen sind, den Garaus macht und uns damit vor Krankheiten schützt, zerstört sie gleichzeitig auch den natürlichen Schutzmantel der Haut. Unsere Hände werden durch ihren häufigen Gebrauch trocken und anfälliger für Allergien und Ausschläge. Ich erinnere mich noch gut an die leeren Seifenregale in den Supermärkten und Drogerien während der ersten Pandemiewelle und daran, wie verwundert ich war, in den Regalen daneben immer noch genügend Handcreme vorzufinden.
Noch mehr erstaunt mich aber die Vorstellung, Seife wortwörtlich dazu verwenden zu wollen, das Sprechen von „falschen“ und „dreckigen“ Wörtern und Sprachen zu reinigen und dabei eine möglichst „saubere“ Sprache als etwas Erstrebenswertes zu begreifen. Als wäre Sprache nicht immer schon stets im Fluss gewesen, wandel- und dehnbar, sich durch den Kontakt mit anderen Sprachen, Idiolekten und Registern immer wieder produktiv kontaminierend. Und bietet ein solcher Dirty Talk nicht auch aus literarischer Perspektive interessanteres Potenzial?
Francis Ponge, der der Betrachtung eines Seifenstücks ein ganzes Buch widmete, beschrieb den Schaum der Seife als ihre Sprache, mit der sie sich bis zu ihrer eigenen Auflösung mitteile. Das Wasser, das das Verschwinden des Seifenstücks verursacht hat, behalte dagegen die „Spuren seines Verbrechens“: Es wird von der Seife getrübt, verliert seine Klarheit und Oberflächenspannung. Gleichzeitig schäumt das Wasser durch den Kontakt mit der Seife nun selbst, es habe ihre Sprache übernommen, sei „mitteilsamer“ geworden.
Die Sprache ihrer Gedichte – so erklärte Cecilia Vicuña in ihrem Vortrag – sei nicht Spanisch, sondern eine spanische Sprache „gone wrong by the presence of the water“, eine, die vom Wasser des Flusses Mapocho ausgewaschen und verformt werde. Dies gelingt ganz ohne Seife.
Juliana Kálnay achtet beim Seifenkauf eher auf den Geruch als auf den Geschmack und bevorzugt beim Händewaschen Flüssigseife gegenüber einem Seifenstück, da sie befürchtet, wenn ihr dieses aus der Hand gleiten und sie darauf ausrutschen würde, würden ihr vor Schreck einige schmutzige Wörter entweichen, die mit einem literarisch (oder anderweitig) produktiven Dirty Talk nur wenig zu tun haben.